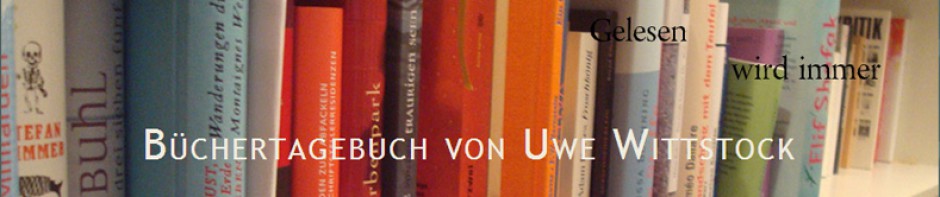Nick Hornby erzählt von einer Teenager-Schwangerschaft
Wenn es einen Skater vom Skateboard haut und er dabei so übel stürzt, dass er „Beton frisst“, dann spricht er von einem „Slam“. Sam ist Skater und 15 Jahre alt, als er den Slam seines Lebens baut. Allerdings nicht auf der Halfpipe beim Skaten, sondern im Bett mit seiner kaum älteren Freundin Alicia. Die beiden sind nur ein einziges Mal unvorsichtig im Umgang mit dem Kondom, nur einen Moment lang leichtsinnig, und nun bekommen sie ein Kind. Slam. Der englische Erzähler Nick Hornby ist ein fabelhaft genauer Beobachter der Gegenwart. Trotz all der Neuen Archivisten des deutschen Pop-Romans sehe ich hierzulande neben Max Goldt keinen Schriftsteller, der einen auch nur annähernd so guten Blick für die Moden und Marotten, die Belustigungen und Belästigungen unseres aktuellen westlichen Alltags hätte. Doch anders als Goldt zimmert Hornby aus diesem Zeitgeistmaterial eben keine Kolumnen, sondern erfindungsreiche und ein wenig schräg dahinschlingernd Geschichten über ein Großstadtmilieu, das mit materiellen Gütern meist nicht überreich gesegnet ist. Doch Hornby ist nicht nur ein Erzähler, er ist zugleich auch so etwas wie ein postmoderner Moralist. In seinen besten Romanen, in „About a Boy“ und „A Long Way Down“, vor allem aber in „How to be Good“ bringt er die Biographien seiner Figuren angesichts eines Lebens ohne religiöse Gewissheiten und ohne unumstrittene weltanschauliche Orientierung gründlich ins Trudeln. So unterhaltsam und witzig seine Geschichten üblicherweise auch sind, so ungeniert und direkt geht es in ihnen immer wieder um Depression, Selbstmord und Sinnsuche. Doch nur in „How to be Good“, seinem in meinen Augen bislang besten Buch, hatte Hornby den Mut, seine Helden an ihren Problemen scheitern zu lassen. In den übrigen geht mal mehr, mal weniger deutlich der Therapeut und Lebenshelfer mit ihm durch. Er macht dann aus seinen Figuren exemplarische Fälle, anhand derer er seinen Lesern vorführt, wie sie sich auf strikt diesseitigen Wegen und ohne allen esoterischen Schabernack in einer kühl aufgeklärten Welt ein wenig soziale Geborgenheit und Lebenssinn für den Eigenbedarf sichern können. Was vermutlich zum enormen Erfolg seiner Romane beigetragen hat. An der Geschichte von Sam und Alicia und ihrer allzu frühen Elternschaft könnte Hornby möglicherweise zweierlei gereizt haben. Zum einen hat die Quote der Teenager-Schwangerschaften in Großbritannien ein beachtliches Niveau. Zwar ist sie noch nicht so hoch wie die der Vereinigten Staaten, die sich auf diesem Feld ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Indonesien liefern. Aber sie ist doch bald dreimal höher als in Deutschland, fast fünfmal höher als in Schweden oder der Schweiz. Zum anderen kann man – hier macht sich der Moralist Hornby bemerkbar – Kinder die Kinder bekommen mit einigem Recht als die Opfer einer weitgehend liberalisierten Gesellschaft betrachten, die ihrem Nachwuchs als letzte verbindliche Richtschnur in allen sexuellen Lebenslagen nur noch ein Kondom in die Hand zu drücken weiß. Hornby erzählt den Roman ganz aus der Perspektive Sams. Der ist sich zwar jener kurzen koitalen Nachlässigkeit durchaus bewusst, die zur Zeugung führt, hat aber von dieser Sekunde an auf all das, was folgt und sein Leben radikal verändert, fast keinen Einfluss mehr. Das lässt ihn im Verlauf der Geschichte umso mehr als Opfer erscheinen. Doch so wie Hornby ihn beschreibt, muss man als Leser nie wirklich Angst um Sam haben. Er wirkt bei aller altersgemäßen Verspieltheit, Realitätsflucht und Naivität zu gefestigt und geborgen, als dass man ihm je bodenlose Verantwortungslosigkeit oder ebensolche Verzweiflung zutraute. Kommt hinzu, dass auch die Eltern von Sam und Alicia zwar nicht gerade vorbildlich, aber doch einigermaßen vernünftig darauf reagieren, deutlich früher als erwartet in den Großelternstand einzutreten. Sams Mutter, die ihren Sohn seinerzeit ebenfalls mit sechzehn zur Welt brachte, bringt noch dazu einschlägige Erfahrung beim Management derartiger Familienkrisen mit. Mit anderen Worten: Rundum erfreut ist keiner der Beteiligten, aber alle bemühen sich, möglichst besonnen zu bleiben, möglichst das Beste aus der Situation zu machen und sorgen so dafür, dass die Lebensläufe des jugendlichen Unglücksrabenpaars nicht komplett entgleisen. Das ist natürlich schön für Sam und Alicia, aber schlecht für den Roman. Unter erzählerischen Gesichtspunkten ist eine eintretende Katastrophe immer dankbarer als eine vermiedene Katastrophe. Bei aller Sympathie für Hornbys lebenshelferische Leidenschaften, doch ein derart lauwarmes, penetrant gut gemeintes Buch hat er noch nie abgeliefert. Es wirkt gelegentlich wie ein mit literarischen Mitteln illustrierter Ratgeber über dem Umgang mit verfrühten Schwangerschaften, fast ist man versucht, im Anhang nach Adressen einschlägiger Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen zu suchen. Zum Ratgeber-Genre passt dann auch, dass „Slam“, ganz untypisch für Hornbys Romane, über weite Strecken ohne jeden Witz, ohne jede Komik auskommen muss. Sicher, als Vater von drei halbwüchsigen Söhnen, werde ich froh sein, wenn sie dieses Buch lesen und werde hoffen, dass sie begreifen, wie gründlich schon ein winziges sexuelles Malheur ihr Leben umkrempeln kann. Zugleich werde ich aber hoffen, dass sie fühlen, wie viel besser Romane sein können. Auch die von Nick Hornby. Gerade die von Nick Hornby. Mit „Slam“ ist er kurz gesprungen und weit unter seinem Niveau gelandet.
Nick Hornby „Slam“ Aus dem Englischen von Clara Drechsler und Harald Hellmann Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008 301 Seiten, 17,95 €